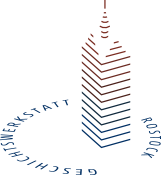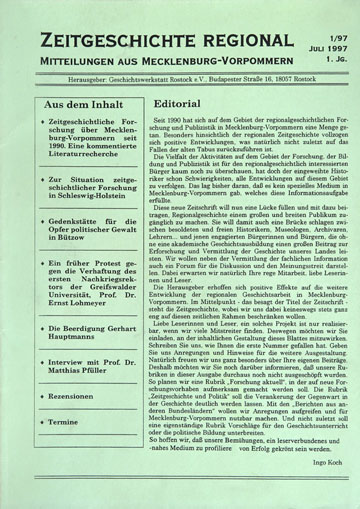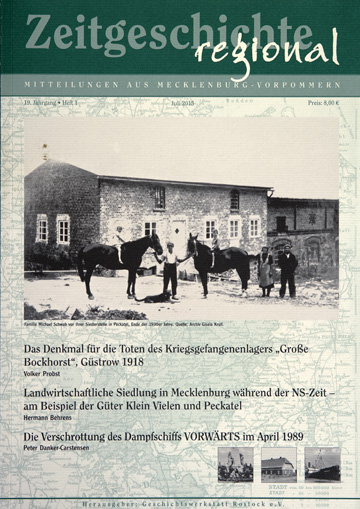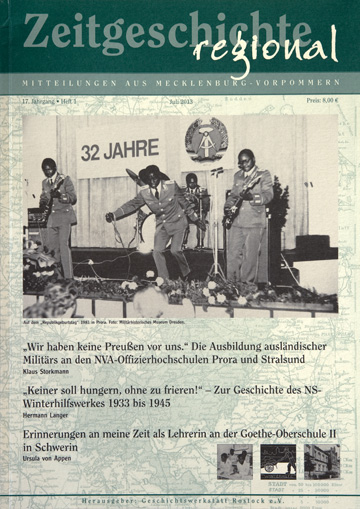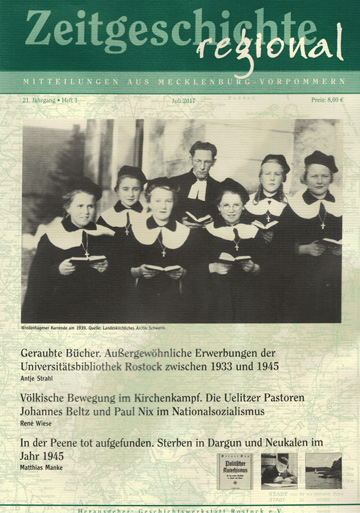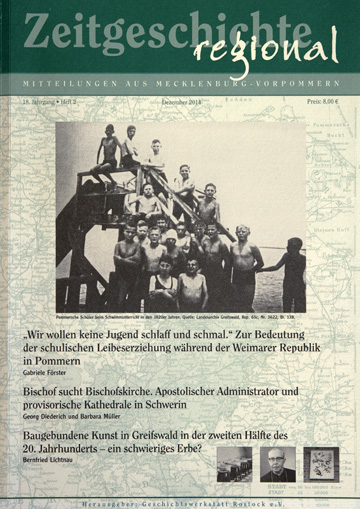Editorial
Wieder einmal sind wir unserem Vorsatz, nicht über einen Heftumfang von 120 Seiten hinausgehen zu wollen, untreu geworden. Die erste Ausgabe von "Zeitgeschichte regional" in 2015 nimmt den gesamten, für diese Zeitschrift definierten Horizont in den Blick. Im engen Verständnis von Zeitgeschichte als Geschichte der Lebenden ist der Erste Weltkrieg bereits hinter diesem Horizont versunken. Gleichwohl wird für das Verständnis des 20. Jahrhunderts die Einbeziehung dieser Zäsur unverzichtbar bleiben. Auch wenn die Schlachten des Ersten Weltkrieges weit außerhalb der Grenzen Mecklenburgs und Pommerns geschlagen wurden, hat dieser Krieg auch hier materielle Spuren hin terlassen. Der Geschäftsführer der Ernst Barlach Stiftung Güstrow, Volker Probst, berichtet über die interessante Geschichte eines Denkmals für die Toten des Kriegsgefangenenlagers "Große Bockhorst" in Güstroui, das 1918 noch während des Krieges entstand. 30 Jahre später warf der Zweite Weltkrieg noch viel größere und dunklere Schatten. Dessen Ende jährt sich 2015 zum 70. Mal, was bedeutet, dass heute Lebende diese Zeit und ihre Vorgeschichte nur als Kinder oder Jugendliche erlebt haben können. Die Erinnerungen des heute in Israel lebenden Abraham Grossmann an die „Polenaktion“, bei der 1938 aus dem 1918 neu entstandenen Polen nach Deutschland eingewanderte Juden wieder nach Polen abgeschoben wurden, sind die Rückblicke eines Erwachsenen. Er beschreibt die Geschichte eines Jungen, der mit dieser „Aktion" aus Güstrow nach Polen gebracht wurde, sich dieser aber widersetzte. Weitere Aufsätze und Berichte befassen sich ebenfalls mit dem Nationalsozialismus. Jan Mittenzwei ist bei seinen Forschungen über die „Kamptzeit“ der pommerschen NSDAP zwischen 1931 und 1934 in russischen Archiven auf hierzulande bislang unbekannte Quellen gestoßen. Die NSDAP-Politik im ländlichen Mecklenburg beleuchtet Hermann Behrens aus Neubrandenburg am Beispiel von Siedlungspolitik auf den Gütern Klein Vielen und Peckatel. Die Angebote zur Integration in die „Volksgemeinschaft" waren von Beginn an von mehr oder weniger gewaltsamem, letztlich mörderischem Ausschluss von Menschengruppen aus der Gesellschaft begleitet. Die Rostocker Kathleen Haack und Ekkehardt Kumbier fassen in diesem Heft ihre Forschungsergebnisse zu den "Euthanasie" genannten Krankenmorden in Mecklenburg zusammen. Falk Bersch dokumentiert anhand von zwischen 1936 und 1940 verfassten Briefen eines Zeugen Jehovas, der in den Strafanstalten Neustrelitz-Strelitz, Dreibergen-Bützow und dem Konzentrationslager Sachsenhausen inhaftiert war, beispielhaft die Erfahrungen von aus der "Volksgemeinschaft" ausgeschlossenen Menschen. Wilhelm Wohler starb 1940 im Lager Sachsenhausen. Die Gewalterfahrungen von Deutsch en am Ende des Krieges, insbesondere östlich von Oder und EIbe, sind auch 70 Jahre nach Kriegsende noch ein Thema emotional geführter Auseinandersetzungen. Vor diesem Hintergrund erscheinen die 1946 entstandenen Porträt- und Gruppenaufnahmen sowjetischer Soldaten aus dem Nachlass der Wittenburger Fotografin Elli Hartmann gleichsam unwirklich. Thomas Kühn vom Museum für Alltagskultur der Griesen Gegend in Hagenow beschreibt diesen Bestand von Glasplattennegativen, aus dem eine Ausstellung erarbeitet wurde, die .ein anderes Gesicht der Roten Armee" zeigt. 2015 wird auch an die Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands vor einem Vierteljahrhundert erinnert. Forschungen zur DDR-Geschichte hatten in den vergangenen Jahren beispiellose Konjunktur. Die Diskussion über das Erbe der DDR war immer ein Teil dessen und wird es bleiben. Der Greifswalder Kunsthistoriker Bernfried Lichtnau schließt in dieser Ausgabe seine Erörterungen über die Charakterisierung der bis 1990 in Greifswald entstandenen baugebundenen Kunst ab. In Rostock finden seit Jahren hitzige Debatten über den richtigen Umgang mit dem maritimen Erbe statt. Der Untergang der lange Zeit als Wahrzeichen des Rostocker Stadthafens angesehenen GEORG BÜCHNER auf dem Weg zur Verschrottung 2014 wird gemeinhin als ein Tiefpunkt angesehen. Der langjährige Direktor des Rostocker Schifffahrtsmuseums Peter Danker-Carstensen beschreibt die Verschrottung des Dampfschiffs VORWÄRTS im April 1989 als Vorgeschichte für den heutigen Umgang mit dem maritimen Erbe in Rostock. Diese Zeitschrift hat mehrfach der Debatte über den Umgang mit der Geschichte der Bausoldaten, insbesondere in Prora, Raum gegeben. Für den Verein PRORAZENTRUM stellt Birte Kröncke das Ausstellungsprojekt "Opposition und Widerstand - Bausoldaten in Prora 1964-1989/90" vor. Die Darstellung der Geschichte der Schweriner Baptistengemeinde in der DDR-Zeit in dem vom Schweriner Stadtarchiv anlässlich der 850-Jahr-Feier herausgegebenen Sammelband zur Geschichte Schwerins stößt auf Widerspruch von Daniel Jung. Er unternimmt den Versuch einer Richtigstellung. Unter der Rubrik „Dokumente" weist Horst Sieber auf einen Altbestand im Schweriner Archiv der AOK Nordost hin: einen 255-seitigen Protokollband der Beratungen des Vorstandes der Sozialversicherungsanstalt Mecklenburg 1946-1950. Und Mathias Rautenberg fand im Archiv der Stiftung Mecklenburg einen Briefwechsel Annalise Wagners mit dem Vorstand der Stiftung Mecklenburg in Ratzeburg, in dem sie ihre Übersiedlung nach Ratzeburg mit ihrer Sammlung anbot. Die Übersiedlung kam nicht mehr zustande. 25 Jahre Geschichte deutscher Einheit sind nun selbst Gegenstand historischer Forschung und Auseinandersetzung. Sinnbildlich dafür steht der Bericht Eckart Schörles, der in den vergangenen zwei Jahren für die Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-Vorpommern eine Gedenkstättenkonzeption erarbeitet hat. Er berichtet über die beim Landesgedenkstättenseminar 2015 gezogene Bilanz und die dort vorgestellten Perspektiventwürfe für die Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Rezension besonderer Art bietet Thomas Prenzel. Der Rostocker Politikwissenschaftler hat in „Zeitgeschichte regional" bereits 2012 seine Analyse der Ereignisse vom Sommer 1992 in Rostock-Lichtenhagen vorgestellt. Hier untersucht er Stärken und Grenzen des Spielfilms "Wir sind jung. Wir sind stark" über die Ausschreitungen von Lichtenhagen. Dieses Thema wird ein zentraler „Erinnerungsort" in der Geschichte unseres Landes bleiben, worauf auch die Gedenkstättenarbeit reagieren muss.
Ihre Redaktion
Inhalt
E d i t o r i a l
A u f s ä t z e
Volker Probst
Das Denkmal für die Toten des Kriegsgefangenenlagers „Große Bockhorst“, Güstrow 1918. Ein Beitrag zur Sepulkralkultur in Mecklenburg
Jan Mittenzwei
Höhepunkt der „Kampfzeit“ – Die pommersche NSDAP zwischen Auflösung und „Machtergreifung“ 1931-1934
Hermann Behrens
Landwirtschaftliche Siedlung in Mecklenburg während der NS-Zeit – am Beispiel der Güter Klein Vielen und Peckatel
Kathleen Haack/Ekkehardt Kumbier
Die nationalsozialistische „Euthanasie“-Aktion in Mecklenburg – Ein Überblick
Bernfried Lichtnau
Baugebundene Kunst in Greifswald aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – ein schwieriges Erbe?
Teil 11: Bildende Kunst im öffentlichen Raum von den 1960er Jahren bis zum Ende der DDR 1990
Peter Danker-Carstensen
Die Verschrottung des Dampfschiffs VORWÄRTS im April 1989. Ein unzeitgemäßer Beitrag zum Umgang mit dem maritimen Erbe in Rostock
D o k u m e n t e
Falk Bersch
Die Briefe des Zeugen Jehovas Wilhelm Wohler aus den Strafanstalten Neustrelitz-Strelitz, Dreibergen Bützow und dem Konzentrationslager Sachsenhausen 1936 bis 1940
Horst Sieber
Protokolle von den Beratungen des Vorstandes der Sozialversicherungsanstalt Mecklenburg 1946-1950
Mathias Rautenberg
„… eine Basis für ein Gedächtnis des einstigen Meckl. Strelitz…“ Annalise Wagner und die Stiftung Mecklenburg
E r i n n e r u n g e n
Abraham Grossmann
Erinnerungen eines polnischstämmigen Juden aus Güstrow an die .Polenaktion“ 1938
D i s k u s s i o n
Daniel Jung
Zur Geschichte der Schweriner Baptistengemeinde. Der Versuch einer Richtigstellung
Thomas Prenzel
Zeitgeschichte im Spielfilm. „Wir sind jung. Wir sind stark“ thematisiert die Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen im Sommer 1992
R e g i o n a l e G e s c h i c h t s a r b e i t
Thomas Kühn
Ein anderes Gesicht der Roten Armee. Elli Hartmanns Fotografien sowjetischer Soldaten von 1946
Birte Kröncke
„Opposition und Widerstand – Bausoldaten in Prora 1964-1989/90″. Ein Ausstellungsprojekt des PRORAZENTRUMs
Eckart Schörle
Perspektiven der Gedenkstättenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern – Eine Bilanz nach 25 Jahren deutscher Einheit. Eindrücke vom Landesgedenkstättenseminar 2015
A r c h i v m i t t e i l u n g e n
EleonoreWolf
Höher, schneller, weiter… Das Neubrandenburger Stadtarchiv ist umgezogen
A u s a n d e r e n L ä n d e r n
Simone Labs
Kalter Krieg im Baltikum – Erlebnisbericht einer Partnerschaft. TeilV: Abschied in Dänemark
R e z e n s i o n e n / A n n o t a t i o n e n
Nenz, Cornelia
Mt allen Fibern des Empfindens. Aus der 750-jährigen Geschichte von Stavenhagen
(Wolf Karge)
Höll,Rainer
Festschrift 750 Jahre Anklam
(Jürgen Tremper)
Rätzke, Dorian
Schloss Bothmer
(Jürgen Tremper)
Diederich, Ceorg M.
Gottvertrauen und Selbstbehauptung. Geschichte der Gemeinde St. Anna und ihrer Kirche
(Wolf Karge)
Neumärker, Klaus-Jürgen
Der andere Fallada
(Jürgen Tremper)
Jikeli, Günther/Werner, Frederic
Raketen und Zwangsarbeit in Peenemünde
(Andreas Wagner)
Foitzik, Jan
Sowjetische Kommandanturen und deutsche Verwaltung in der SBZ und frühen DDR
(Christoph Wunnicke)
Frank, Mario
Gauck. Eine Biographie; Legner, Johann, Joachim Gauck. Träume vom Paradies
(Christoph Wunnicke)
Cammin, Franziska
Die Deutsche Seereederei als Staatsreederei der DDR
(Andreas Stirn)
Wüsthoff, Hans-Jürgen
60 Jahre Weststadt. Ein Schweriner Stadtteil
(Bernd Kasten)
Uebachs, Peter
Stasi und Studentengemeinde
(Wolf Karge )
Achenbach, Björn
Hansa ist mein Leben. F.C. Hansa Rostock – seit 1965
(Matthias Glasow)
N e u e r s c h e i n u n g e n
K u r z v o r s t e l l u n g d e r A u t o r e n
A d r e s s e n d e r A u t o r e n
I m p r e s s u m